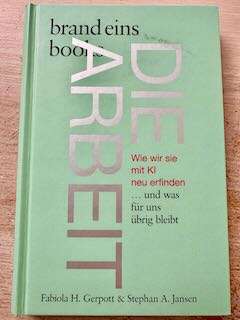Dynamische Kreativität und KI 2025
Kreativität und KI: Kreativität ist von der KI nicht erzeugbar – sondern ein künstlerischer Prozess, der auf dem Geistigen im Menschen fußt. Die Sehnsucht nach dem Geistigen Inmitten des digitalen Zeitalters, in dem Künstliche… Dynamische Kreativität und KI 2025