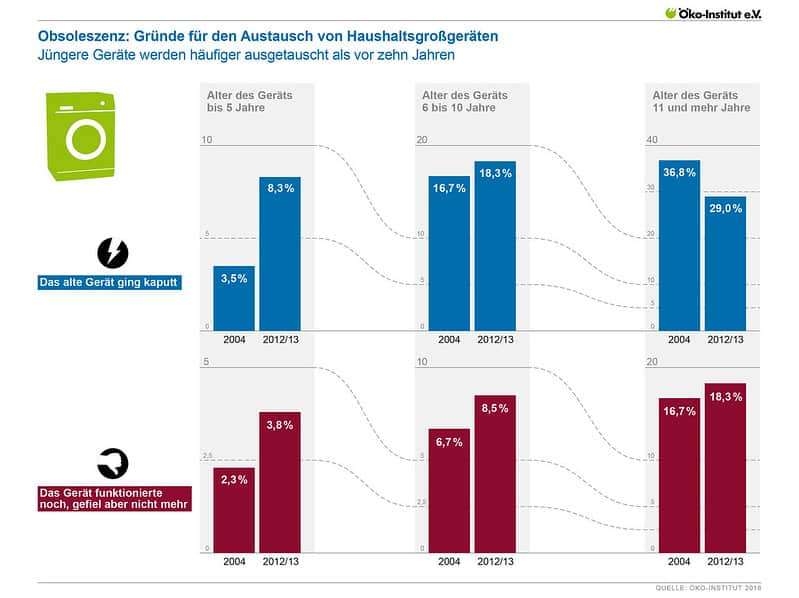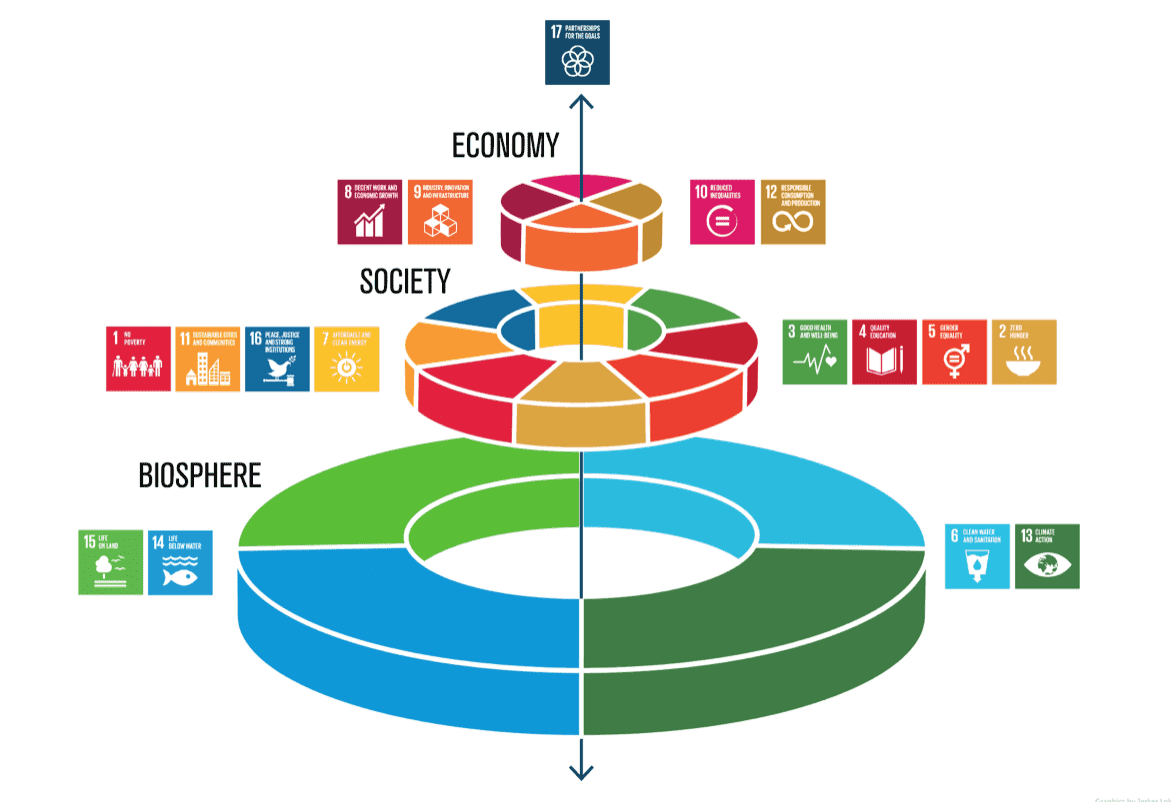Purpose-driven Leadership in Deutschland 2026
Veröffentlicht am: 17. February 2026 | Letzte Aktualisierung: 17. February 2026 Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick: Purpose-Driven Leadership steigert Mitarbeiterengagement um durchschnittlich 40% Was ist Purpose-Driven Leadership? Purpose-Driven Leadership bedeutet, Führung auf einen klaren… Purpose-driven Leadership in Deutschland 2026